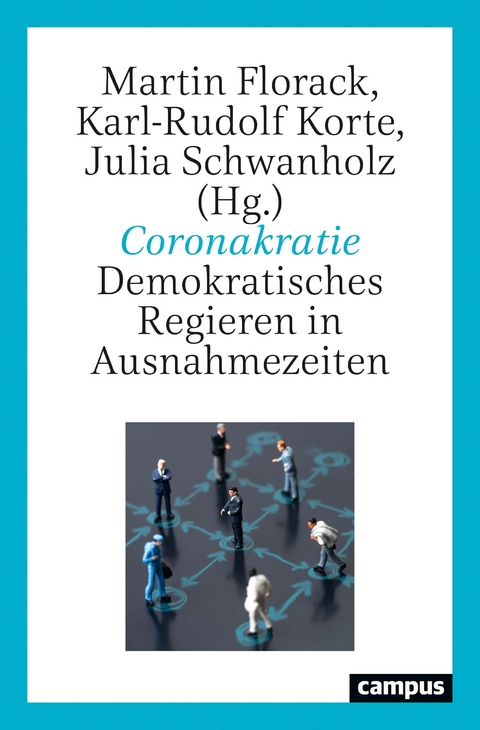Deutschland im Jahr der Bundestagswahl
Was hält uns zusammen?
Vor welchen gesellschaftlichen Herausforderungen steht die deutsche Demokratie? Wie können wir ihnen begegnen, um das demokratische Wertefundament und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken? Diese und weitere Fragen beantwortet uns Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, einer der angesehensten Politikwissenschaftler für Regierungs- und Parteienforschung im deutschsprachigen Raum. Prof. Korte ist seit 2003 Professor für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und Gründer und Direktor der NRW School of Governance.

Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte ist seit 2003 Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt "Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Staatstheorien" an der Universität Duisburg-Essen. Prof. Korte ist außerdem seit 2006 Direktor der "NRW School of Governance". Der Parteien- und Wahlforscher begleitet seit fast 20 Jahren regelmäßig Wahlsendungen im deutschen Fernsehen.
Karl-Rudolf Korte
HSS: Zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 stärkte das politische Krisenmanagement das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in Regierung und Politik. Mittlerweile demonstrieren Querdenker und Corona-Leugner fast jedes Wochenende in deutschen Städten. Was hat sich verändert?
Prof. Korte: Die Zeit erschöpft die Bürger: Durchhalteparolen machen müde und nutzen sich ab. Dennoch ist die Zustimmung zur Coronapolitik der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten sehr hoch. Die Protestler sind laut und visuell kreativ unterwegs, aber eindeutig in klarer Minderheit.
HSS: Während der Corona-Pandemie ist es zu einer Verbreitung von Verschwörungstheorien gekommen, die oft auf rechte und antisemitische Narrative zurückgreifen. Wie demokratiefeindlich sind diese Verschwörungstheorien und ihre Anhänger?
Die Unsicherheit treibt Bürger in die Suche nach einfachen Antworten. Diese werden von extremen Positionen aus gegeben. Das ist durch systematische Vernetzung nicht zu unterschätzen und sollte, wenn strafrechtlich möglich, verfolgt und geahndet werden.
HSS: Bei der letzten Bundestagswahl stand die Auseinandersetzung mit dem (Rechts-)Populismus im Mittelpunkt. Nun hat das jüngste Populismusbarometer (WZB, September 2020) einen deutlichen Rückgang populistisch eingestellter Wähler verzeichnet. Welche Rolle spielt die Verbreitung von Verschwörungstheorien für die Aktivierung bestimmter Wählergruppen?
Die Pandemie stärkt die politische Mitte – nicht die Ränder. Die AfD und die Pöbel-Populisten haben keine Expertise zur Lösung der Pandemie – sie verhöhnen sie in vielen Aspekten. Bürger wählen Zukunft, keine Vergangenheitsaufarbeitung. Insofern werden die Parteien stärker, die konkret Leben gerettet haben und den Vorsorgestaat der Zukunft bedienen.
HSS: Deutschland geht mit großen Schritten auf die nächste Bundestagswahl zu. Müssen sich demokratische Parteien mit verschwörungsaffinen Wählergruppen auseinandersetzen?
Nein, in erster Linie müssen die Parteien extrem eigene Wähler mobilisieren. Wer mobilisiert, gewinnt die Wahl. Wer Ideen und wirkungsvoll Personen präsentieren kann, die zum lenkenden, schützenden, sorgenden Staat passen, wird auch gewählt werden. Daseinsvorsorge und Sicherheit waren noch nie so wichtig, wie bei der kommenden Wahl.
HSS: Populismus und Verschwörungstheorien spielen nicht nur in Deutschland eine Rolle, sondern sind ein globales Phänomen. In den USA ist mit Donald Trump ein politischer Unterstützer und Katalysator dieser Themen nun abgewählt worden. Gibt Ihnen das Hoffnung für eine Trendwende?
Ja. Die Demokratie ist die optimistischste Staatsform, die es gibt. Sie setzt sich aus Zuversicht zusammen und Wähler handeln, wie bei Aktien, mit der Zukunft. Es gibt nie nur Serien an Entwicklungen, die automatisch und mit historischer Gesetzmäßigkeit zum Populismus der Extreme führen. Es gibt immer auch Kipppunkte und Trendwenden. Der Blick für die Analyse muss differenziert bleiben. In der Risikogesellschaft muss Politik das Unwahrscheinliche oft managen. Es entspricht eher der politischen Lebenswirklichkeit mit der Abweichung und nicht mit der Regel zu rechnen.
HSS: Finanzielle Ängste, soziale Ungleichheit, Rassismus und Diskriminierung – auch andere Faktoren bringen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ins Wanken. Stellen in diesem Zusammenhang die Anhänger von Verschwörungstheorien die aktuell größte Herausforderung dar?
Die größte Herausforderung liegt nicht im finanziellen Bereich. Sondern: Wie machen wir aus der Gemeinschaft der Singularitäten ein Kollektiv der Gemeinsamen? Die Solidaritäts-Bedürftigkeit ist in der Pandemie für alle sichtbar geworden. Wie stärken wir das in einer offenen Gesellschaft? Das sind wichtige Herausforderungen, um Resilienz für neue Krisen zu erwerben und das Unwahrscheinliche gemeinsam zu managen.
HSS: Sehr geehrter Herr Professor Korte, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Das Interview führte Marla Binhack, HSS
Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten
Campus Verlag
Auch in der aktuellen Publikation von Prof. Korte werden die gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Fokus genommen. Der Sammelband „Coronakratie: Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten“ bringt unterschiedliche Stimmen aus der Wissenschaft und den Medien zusammen, um die Chancen und Risiken der Corona-Pandemie für Deutschlands politisches System aufzuzeigen. Unter dem Stichwort der demokratischen Resilienz und der Bewahrung demokratischer Werte wird ein interdisziplinärer Blick in die Zukunft nach der Pandemie geworfen. „Coronakratie: Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten“ erscheint am 10. März 2021 im Campus Verlag.