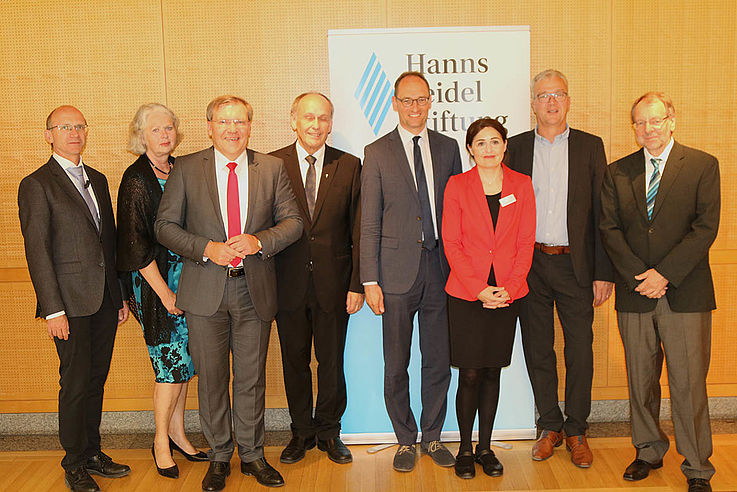Das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) ist 2017 in Kraft getreten. Aus ehemals drei Pflegestufen wurden fünf Pflegegrade. Mit diesen wird das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit eines Menschen festgestellt und die Höhe der finanziellen Unterstützung berechnet. Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist im neuen Gesetz weiter gefasst: Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie Demenz oder Alzheimer erhalten gleichberechtigt mit körperlich kranken Patienten Leistungen. Neu ist außerdem der Grundsatz „mehr ambulante und weniger stationäre“ Pflege.
Pflege 2030 – Interview
Prüfstein für Menschlichkeit

Es gilt jetzt, die richtigen zu Weichen stellen. Denn wie wir künftig mit Pflegebedürftigen umgehen, zeigt, wie menschlich unsere Gesellschaft ist. Nur wenn wir das Pflegepersonal wertschätzen, finanziell und gesellschaftlich, können Hilfsbedürftige gut versorgt werden.
©photographee.eu/pantheredia
HSS: 2015 hatten Sie für uns die Tagung „Pflege 2030“ moderiert und einen Artikel geschrieben. Herr Nützel, was haben wir in den vergangenen drei Jahren erreicht, wo stehen wir im Pflegebereich?
Nikolaus Nützel: Ich denke, es ist erreicht worden, dass die neuen Pflegegrade den Bedürfnissen von Menschen, die Pflege brauchen, besser gerecht werden als die vorherigen Pflegestufen. Es ist erreicht worden, dass spürbar mehr Geld für Pflege ausgegeben wird. Es kann also mehr Personal besser bezahlt werden, Angehörige können höhere Geldleistungen erhalten. Allerdings kann man auch mit zusätzlichem Geld nicht von jetzt auf gleich zusätzliches Personal anwerben, wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist. Und genau das ist, nach allem, was man hört, der Fall. Ich denke also, durch die Maßnahmen der vergangenen drei Jahre hat sich die Situation verbessert – rundum gut ist sie aber deshalb noch nicht.

Nikolaus Nützel arbeitet als freier Journalist für den Bayerischen Rundfunk und andere Medien, seit 1995 schwerpunktmäßig über Themen aus den Bereichen Sozialpolitik und Gesundheit.
HSS: Im Pflegebereich stehen wir vor großen Herausforderungen: Wie können die Personalengpässe überwunden werden? Gibt es eine ausgewogene Balance zwischen Bürokratie, Fachlichkeit und Menschlichkeit in der Pflege und wie gelingt kultursensible Pflege? Herr Nützel, welche Lösungsansätze sehen Sie?
Nikolaus Nützel: Ausreichend Personal gewinnen lässt sich nur, wenn der Beruf ein ganz anderes Prestige bekommt. Damit das gelingt, müsste sich vieles ändern – was sich zum Teil nur sehr schwer steuern lässt. Wie angesehen ein Beruf ist, hat ja nicht nur etwa mit der Bezahlung zu tun, sondern das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das sich nur sehr beschränkt z.B. mit Werbekampagnen beeinflussen lässt. Die Balance zwischen Bürokratie und Menschlichkeit muss jeden Tag neu ausgehandelt werden – zwischen denen, die Verantwortung dafür tragen, dass Regeln eingehalten werden, und denen, die eine Rückmeldung geben, wie sinnvoll und praxisnah diese Regeln sind. Kultursensible Pflege kann gelingen – wenn sich alle Beteiligten immer wieder bewusst machen, dass es hier ein Problemfeld gibt, an dem gearbeitet werden muss.
HSS: Welche Auswirkungen hat das zweite Pflegestärkungsgesetz auf die Personal- und Pflegesituation in stationären Einrichtungen und in der ambulanten Pflege? Was bringt das PSG II für Pflegebedürftige?
Nikolaus Nützel: Nun ja, ich berichte als Journalist ja nur über diese Themen und kann bei einer Antwort auf eine solche Frage nur auf das zurückgreifen, was mir Leute berichten, die näher dran sind. Und von denen höre ich, dass sich die Personalsituation nicht wesentlich verbessert hat. Denn die Pflegegesetze lassen zwar mehr Geld fließen – aber man kann ja nicht per Gesetz verordnen, dass sich mehr Menschen für einen Beruf in der Pflege interessieren. Deswegen müssen heute überall, wo Menschen leben, Strukturen aufgebaut werden, die helfen, dieses Problem zu bewältigen. Die Lösungen können nicht alleine aus den Gesundheitsministerien auf Bundes- oder Landesebene kommen. Sie müssen von unten erarbeitet werden. Für Pflegebedürftige bringen die jüngsten Gesetzesänderungen, nach dem was man hört, durchaus höhere Ansprüche und eine realitätsnähere Beurteilung ihres Bedarfs. So erklärt sich auch, dass die Zahl derjenigen, die Leistungen der Pflegeversicherung beziehen, zügig gestiegen ist.
HSS: In ihrem Artikel haben Sie das schlechte Image der Pflege angemahnt: Wie ist es um das Image der Pflege heute bestellt? Wie können Attraktivität und Wertschätzung des Pflegeberufs gesteigert werden?
Nikolaus Nützel: Vielleicht ist das Image durch verschiedene Kampagnen und auch durch die öffentliche Diskussion über die Bedeutung der Pflege etwas besser als vor einigen Jahren. Aber ich fürchte, wirklich viel besser ist dieses Image heute noch nicht. Im Kino-Kassenschlager „Fack ju Göthe III“ haben sich die Drehbuchautoren einen Spaß daraus gemacht, darzustellen, was für eine grauenvolle Vorstellung es sei, Pflegerin zu werden. Das Publikum fand das ziemlich witzig. Das sagt eine Menge aus. Die Attraktivität des Pflegeberufes lässt sich zum einen wohl durch eine Bezahlung steigern, die wirklich so gut und verlässlich ist, dass jeder junge Mensch sofort weiß: „da lohnt sich die Arbeit“. Und es müssten mehr – vor allem junge – Menschen die Erfahrung machen, wie Pflege wirklich ist. Menschen, die Positives in und mit der Pflege erlebt haben, müssten Multiplikatoren werden.
HSS: Die Pflege ist vom demografischen Wandel in mehrfacher Hinsicht betroffen:
(1) Mit steigender Lebenserwartung wächst das Risiko, pflegebedürftig zu werden, die Zahl der Pflegefälle nimmt zu.
(2) Veränderte Familienstrukturen verringern die Möglichkeiten häuslicher Pflege durch Familienangehörige.
(3) Der Geburtenrückgang bewirkt, dass weniger Pflegekräfte zur Verfügung stehen.
(4) Der Anteil pflegebedürftiger Personen mit Migrationshintergrund steigt.
Haben wir den demografischen Wandel in seinen Auswirkungen auf den Pflegesektor unterschätzt?
Nikolaus Nützel: Ich fürchte: Ja, es wird immer noch völlig unterschätzt, was es bedeutet, wenn der geburtenstärkste Jahrgang 1964 insgesamt rund 1,4 Millionen Männer und Frauen zählt – während die Jahrgänge der Kinder dieser Baby-Boomer nur halb so stark sind: Rund 700 000. Was es bedeuten wird, wenn viele Baby-Boomer in 30 oder 40 Jahren Pflege brauchen, das können wir uns heute immer noch nicht wirklich vorstellen – wo wir doch jetzt schon beträchtliche Probleme haben.
HSS: Was wünschen sie sich für die nächsten 3 Jahre? Was müsste sich bis dahin verbessert haben?
Nikolaus Nützel: Ich wünsche mir, dass die Pflege nicht als eine Mischung aus „Gnadenhof für Menschen“ und immer schwerer tragbarer Kostenfaktor gesehen wird. Ich wünsche mir, dass die Pflege von immer mehr Menschen als ein Bereich erkannt wird, in dem echter Wohlstand geschaffen wird. Es sollte endlich allen klar werden: Steigende Ausgaben für die Pflege sind nicht in erster Linie eine Belastung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, weil sie die Lohnnebenkosten steigen lassen. Steigende Ausgaben für die Pflege gehen vielmehr mit besserem Leben für viele Menschen einher, also mit wachsendem Wohlstand. Und zwar mit einem Wohlstand, den ich viel mehr als echten Wohlstand empfinde, als den Wohlstand, den viele darin sehen, dass beispielsweise immer mehr und immer höher motorisierte Autos auf unseren Straßen fahren.
HSS: Herr Nützel, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Dr. Susanne Schmid
Leiterin