- Wahlen im Schatten der Pandemie
- Negative Stimmung durch Corona
- Wahlen im Homeoffice: Rekord bei Briefwahl
- Das Wahlergebnis
- Perspektiven für die Bundestagswahl
Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021
Auftakt zum Superwahljahr
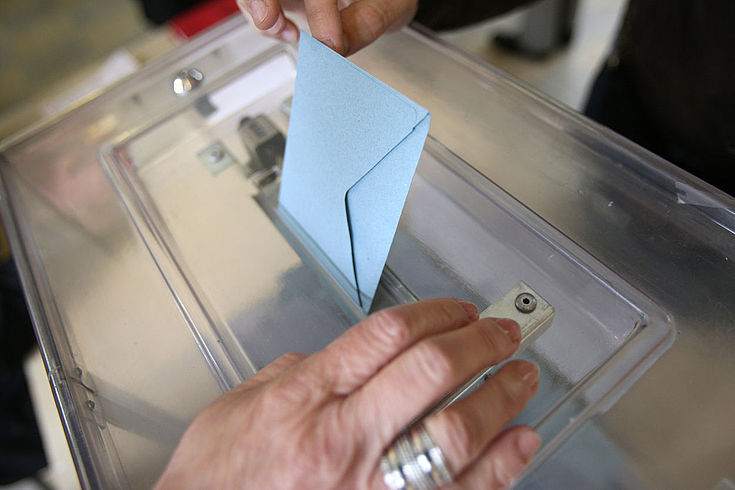
Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
IStock, Catherine Leblanc
Nach dem Auftakt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz folgen Wahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie möglicherweise noch in Thüringen. Die beiden Landtagswahlen vom 14. März sind daher nicht nur ein Fingerzeig zu Beginn des Superwahljahres, sie sind auch die ersten Wahlentscheidungen, die mitten in der Corona-Krise und nach dem zweiten bundesweiten Lockdown durchgeführt wurden. Insofern war zu erwarten, dass sich die Wahrnehmungen der Krise und deren Folgen auf das Ergebnis auswirken würden.
Wahlen im Schatten der Pandemie
Die Pandemie als übergeordnetes bundespolitisches Thema dominierte dabei die Landespolitik, für die die Bewältigung der Folgen von Covid-19 natürlich auch die jeweilige größte landespolitische Herausforderung darstellte. Laut Forschungsgruppe Wahlen stellte die Corona-Krise in Baden-Württemberg kurz vor der Wahl für 66% das wichtigste Problem dar; 21% nannten Umwelt/Klima/Energiewende und 14% Bildung/Schule. In Rheinland-Pfalz war für 60% die Corona-Krise das wichtigste Problem; es folgten mit 19% das Thema Defizite Infrastruktur und Internet sowie Bildung/Schule mit 18%. Krisenzeiten stellen meistens Rahmenbedingungen, in denen die Bürger Hoffnung in die Handlungsfähigkeit der amtierenden Regierung setzen und ihrer Regierung einen Vertrauensvorschuss zubilligen. In beiden Ländern war zu erkennen, dass dieses Vertrauen vorhanden war und sich kein großer Drang nach einem Regierungswechsel ergab. Dies war besonders deutlich in Baden-Württemberg, wo Winfried Kretschmann von den Grünen sein Image als fürsorglicher Landesvater voll zur Geltung bringen konnte. Laut FG Wahlen sprachen sich kurz vor der Wahl 70% der Bürger in Baden-Württemberg für Kretschmann als Ministerpräsidenten aus; nur 11% für seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU. Sogar unter den CDU-Anhängern waren zuletzt 60% für Kretschmann und 28% für Eisenmann. In Rheinland-Pfalz hatte die Regierungschefin Malu Dreyer immer mehr an Zustimmung gewonnen und lag laut FG Wahlen kurz vor der Wahl bei 58% Zustimmung; ihr Herausforderer Christian Baldauf von der CDU kam auf 28%. Anders als in Baden-Württemberg kam die Unterstützung für die Ministerpräsidentin vorwiegend aus den Lagen der Wähler von SPD und Grünen, während die Wähler von CDU, FDP und AfD mehrheitlich den CDU-Kandidaten bevorzugt hätten.
Auch wenn das Rennen in Rheinland-Pfalz länger offen gewesen sein mag, so hat doch die Pandemie und ihre Folgen den Wahlkampf und die Wahl selbst überschattet. Kurz vor der Wahl wurde in Baden-Württemberg laut FG Wahlen den Grünen die größte Kompetenz bei der Lösung der Probleme im Zuge von Corona zugebilligt; in den Feldern Schule/Bildung und Wirtschaft lag die CDU vorn. In Rheinland-Pfalz lag die SPD bei Corona deutlich und in den anderen Bereichen leicht vor der CDU als größte Oppositionspartei.
Die Regierungsparteien hatten also durch die Corona-Krise einen Startvorteil – ohne die Dominanz dieses Themas in den Monaten vor dem Wahltermin hätte es also auch anders ausgehen können. Dabei konnte die CDU, die Teil der Regierungskoalition in Baden-Württemberg war, offenbar weniger von dieser Konstellation profitieren als die Grünen.
Negative Stimmung durch Corona
Die Dynamik, die die Corona-Krise und deren Folgen auslöste, zeigt sich auch in der Entwicklung der Sonntagsfrage: Seit Dezember 2016 war die CDU in Rheinland-Pfalz (zum Teil deutlich) vor der SPD gelegten – erst Anfang März 2021 konnte sich die SPD wieder vor die CDU schieben. Am Donnerstag vor der Wahl lag die SPD laut FG Wahlen mit 33% klar vor der CDU mit 29% (Grüne 10%, AfD 9%, FDP 6,5%, Freie Wähler 5%, Linke 3% und Sonstige 4,5%. Das INSA-Institut ermittelte am Tag darauf für die SPD einen Punkt weniger und für AfD sowie FW einen Punkt mehr). In Baden-Württemberg war die CDU zwar in den meisten Umfragen seit der letzten Wahl hinter den Grünen geblieben, aber erst Anfang März 2021 sind die Differenzen größer geworden und hatten bei der FG Wahlen bis zu 11 Prozentpunkte erreicht. In den letzten Umfragen am Donnerstag vor der Wahl lag die CDU mit 24% noch klar hinter den Grünen mit 34% (die anderen Parteien: AfD und FDP jeweils 11%, SPD 10%, Linke 3% und Sonstige 7%. Das INSA-Institut hatte einen Tag später die CDU mit 23% und die Grünen mit 32%, dafür wie üblich die AfD höher bei 13% gemessen). Hinzu kam eine zuletzt mehrheitliche Zufriedenheit mit der Landesregierung (56% in Rheinland-Pfalz und 59% in Baden-Württemberg laut Infratest dimap), was die Ausgangslage für den Herausforderer CDU nicht erleichterte. Die Regierungsbeteiligung in Baden-Württemberg ließ sich angesichts der Popularität des Ministerpräsidenten nicht in ein positives Momentum umsetzen. Dies wurde durch das Wahlrecht im Land noch unterstützt: Der Wähler hat dort bei der Landtagswahl nur eine Stimme und kann nicht mit Erst- und Zweitstimme unterschiedlich votieren, was noch stärker dazu geführt haben dürfte, dass die Popularität des Ministerpräsidenten den Werten der Partei nützt.
Hinzu kam in beiden Ländern die negative Dynamik der letzten Wochen vor der Wahl: Zum einen war die Kritik an der Corona-Politik in Bund und Land größer geworden und hatte den bundespolitischen Trend gegen die CDU gedreht. Zum anderen kamen die Berichte über einzelne Politiker der Unionsparteien (unter anderem einem Bundestagsabgeordneten aus Mannheim), die sich am Ankauf von Masken zum Schutz gegen Infektionen bereichert haben sollen. Dies trieb die Umfragewerte für die CDU weiter nach unten. Eine Woche vor der Wahl wurde (von election.de) den Grünen eine klare Mehrheit der Direktmandate prognostiziert (14 sicher, 35 wahrscheinlich und 13 Mandate mit Vorsprung). Der CDU wurden lediglich 2 wahrscheinliche und 6 Mandate mit Vorsprung prognostiziert. Für Rheinland-Pfalz war vom selben Institut eine Woche zuvor (also noch vor dem Höhepunkt des Masken-Skandals) etwa ein Gleichstand bei den Direktmandaten zwischen SPD und CDU vorhergesagt worden.
Wahlen im Homeoffice: Rekord bei Briefwahl
Die Pandemie hat einen weiteren Trend verstärkt, der sich bei Wahlen in Deutschland seit einigen Jahren immer weiter verfestigt: Immer weniger Wahlberechtigte wollen selber ins Wahllokal und immer mehr möchten ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Nie zuvor war der Anteil an Briefwählern so hoch wie bei diesen beiden Landtagswahlen vom 14. März 2021. In Rheinland-Pfalz hatten bei der letzten Landtagswahl 2016 30,6% per Brief abgestimmt. Bei dieser Wahl rechnete der Landeswahlleiter mit einer Verdoppelung – was auch eingetreten ist. Eine Woche vor der Wahl hatten bereits 42% der fast 3,1 Millionen Wahlberechtigten per Post abgestimmt. Für Baden-Württemberg wurde mit ähnlichen Zahlen gerechnet. Die Stimmabgabe findet also immer weniger am Wahltag, sondern in einem etwa drei bis sechs Wochen andauernden „Wahlzeitraum“ statt (Zeit-Online, 10.3.2021). Daher könnten kurzfristig aufkommende Entwicklungen – ob positive Entwicklungen bei Impfzahlen oder Skandalmeldungen – den Wahlausgang weniger stark beeinflussen. Umso wichtiger dürften die längerfristig aufgebauten Sympathie- und Kompetenzwerte werden.
Das Wahlergebnis
In beiden Ländern fiel das Ergebnis ähnlich aus wie von den Demoskopen prognostiziert. Die Wahlbeteiligung war niedriger als bei der letzten Landtagswahl – damit wurde ein Trend der letzten Jahre zu wieder mehr Beteiligung gebrochen, was wohl der Corona-Pandemie zuzuschreiben ist. In Baden-Württemberg ging sie von 70,4% auf 63,8% zurück. Der Anteil an Briefwählern betrug laut Infratest dimap 49%. Die Grünen wurden klar stärkste Partei mit 32,6%, mussten aber trotz eines prozentualen Gewinns von 2,4 Punkten einen Verlust von etwa 39.000 Stimmen verkraften. Die CDU büßte fast 380.000 Stimmen ein und kam bei einem prozentualen Verlust von 2,9 Punkten auf 24,1%, dem schlechtesten Wert bei Landtagswahlen überhaupt. Die SPD kam auf 11,0%, die FDP auf 10,5% und die AfD auf 9,7%. Nicht in den Landtag kamen die Linke mit 3,6% und die Freien Wähler mit 3,0%. Einen Stimmengewinn konnten von den größeren Parteien nur die FDP, die Linke und die Freien Wähler verzeichnen. Die FW, die bei der letzten Wahl 2016 4.647 Stimmen holten, kamen diesmal auf 146.193 (jeweils nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis). Von den insgesamt 154 Sitzen kamen die Grünen auf 58 Mandate – allesamt Direktmandate. Die CDU kam auf 42 Mandate, davon 12 Direktmandate. Die anderen Parteien konnten kein Direktmandat holen: Die SPD kam auf 19 Mandate, die FDP auf 18 und die AfD auf 17. Damit wäre sowohl die Weiterführung der bisherigen Koalition aus Grünen und CDU als auch eine Ampelkoalition aus Grünen, SPD und FDP möglich.
Auch in Rheinland-Pfalz ging die Wahlbeteiligung von 70,4% auf 64,4% zurück. Der Anteil an Briefwählern betrug laut Infratest dimap 65%. Die SPD konnte ihr Ergebnis bei den Landesstimmen (Zweitstimmen) fast halten und kam auf 35,7% nach zuletzt 36,2%. Auch dies bedeutete allerdings einen Verlust von fast 80.000 Stimmen. Die CDU büßte allerdings etwa 142.000 Stimmen ein und kam bei einem prozentualen Verlust von 4,1 Punkten auf 27,7%. Die Grünen gewannen 4 Punkte hinzu und kamen auf 9,3%. Die AfD verlor 4,3 Punkte und kam auf 8,3%. Die FDP verlor etwas und kam mit 5,5% noch in den Landtag. Das schafften auch erstmals die Freien Wähler, die 103.582 Stimmen und 5,3% holten. Sie verdoppelten damit ihren Stimmenanteil verglichen mit 2006 (jeweils nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis). Neben den Grünen waren sie die einzige größere Partei, die Stimmen hinzugewinnen konnten. Von den insgesamt 101 Sitzen kam die SPD auf 39, davon 28 Direktmandate. Die CDU kam auf 31, davon 23 Direktmandate. Die Grünen holten 10 Mandate (darunter erstmals ein Direktmandat), die AfD 9 Mandate und FDP und Freie Wähler jeweils 6 Mandate. Damit könnte die bisherige Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen (bei veränderter der Reihenfolge der kleineren Parteien) fortgeführt werden. Theoretisch wäre auch eine Koalition aus SPD und CDU möglich; eine bürgerliche Regierung unter Führung der CDU hätte keine Mehrheit.
Als zentrales Ergebnis beider Wahlen ergibt sich die klare Bestätigung der amtierenden Regierungschefs und der jeweiligen Koalitionen. In Baden-Württemberg profitierten die Grünen von der Popularität des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ebenso wie von der trotz Corona noch hohen Zufriedenheit mit der Landesregierung. Sie sind mittlerweile im Land breit verankert, was nicht nur die hohe Zahl an Direktmandaten zeigt. Ihre Stimmen holen sie dort aus allen Altersgruppen: Laut Infratest dimap kamen sie bei den Erstwählern auf 32% (CDU auf 16%, FDP 15%), aber auch bei den über 60jährigen holten sie 35% (CDU 28%); bei den unter 25jährigen insgesamt 31%. Bei den Frauen sowie den Wählern mit formal höherer Bildung kamen sie auf jeweils 38%. Auch die Grünen haben aber an Vertrauen verloren: So sagten noch 28%, sie trauen den Grünen am ehesten zu, die Probleme des Landes zu lösen. Dies waren 8 Punkte weniger als 2016, aber die CDU kam auch nur auf 24% (vier Punkte Verlust). Bei den Parteikompetenzen lagen sie ebenfalls deutlich vorn bei Umwelt- und Klimapolitik sowie der Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise. Die CDU hatte einen Vorsprung bei Digitalisierung, Schul- und Bildungspolitik, Wohnungspolitik und Wirtschaft. Die SPD lag – wenn auch knapp vor den Grünen – beim Thema Soziale Gerechtigkeit vorn. Dies unterstreicht, dass der CDU ein beachtlicher Kompetenzvorsprung in vielen Feldern zugebilligt wurde, der sich aber nicht in Wählerstimmen umsetzen ließ. Umgekehrt sind die Grünen gerade in Baden-Württemberg schon lange nicht mehr eine Ein-Themen-Partei, aber andererseits werden sie in vielen wichtigen Politikfeldern nicht als führend angesehen. Eine klassische Volkspartei sind sie daher trotz dieses Wahlerfolges im Land nicht.
Dies gilt erst recht für Rheinland-Pfalz, wo sie sich zwar verbesserten, aber das erwünschte zweistellige Ergebnis verfehlten. Dort lagen SPD wie CDU bei fast allen wichtigen Politikfeldern klar vorn und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei die SPD meist leicht vor der CDU lag. Die Grünen zeigten hier nur im Bereich Umwelt/Klima bessere Resultate. Allerdings hat die regierende SPD in allen Feldern deutlich verloren, was aber durch die Popularität der Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin ausgeglichen werden konnte, zumal ihr ein positiver Beitrag bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zugebilligt wurde; 62% sagten, Malu Dreier führe das Land gut durch die Corona-Krise – ein Spitzenwert im Vergleich zu anderen Ländern (Winfried Kretschmann kam auf 43%). Die CDU konnte sich trotz Verlusten als Volkspartei präsentieren, was die hohe Anzahl an gewonnen Direktmandaten ebenso zeigt wie die in vielen Bereichen hohen Kompetenzwerte. Laut infratest dimap verlor sie zwar 43.000 Stimmen an die Nichtwähler, jeweils 17.000 an SPD und Freie Wähler sowie 13.000 an die Grünen, gewann aber 12.000 Stimmen von der FDP und erstmals 4.000 von der AfD.
Das Abschneiden der AfD ist ebenfalls bemerkenswert: Sie kam zwar wieder in beide Landesparlamente, musste aber prozentual gut ein Drittel abgeben. In absoluten Zahlen war der Rückgang noch größer: In Rheinland-Pfalz verlor sie über 108.000 Stimmen gegenüber der letzten Landtagswahl, in Baden-Württemberg sogar 332.000 Stimmen und alle Direktmandate. Laut Infratest dimap gab sie dabei erstmals nicht nur 49.000 Stimmen an die Nichtwähler ab, sondern verlor zusätzlich an alle anderen Parteien. Es wurde deutlich, dass die AfD von der Corona-Krise nicht profitieren konnte; die angekündigte Beobachtung durch den Verfassungsschutz dürfte ihr Bild in der Öffentlichkeit nicht verbessert haben. Extremisten waren bei diesen Landtagswahlen insgesamt keine Krisengewinnler.
Perspektiven für die Bundestagswahl
Die Wahlen vom 14. März 2021 fanden unter außergewöhnlichen Umständen statt, aber eben diese Umstände könnten auch die weiteren Wahlen des Jahres bestimmen. Wahlkampf fast ohne direkten Kontakt zu den Wählern, digitale Kommunikation statt Veranstaltungen: Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass diese Wahlen anders ablaufen mussten als gewohnt. Auch wenn die Wahllokale wie immer geöffnet waren (allerdings in anderen Räumlichkeiten), wollten viele Bürger dort lieber nicht hingehen und haben von der Briefwahl Gebrauch gemacht. Damit wurde ein ohnehin vorhandener Trend verstärkt. Wenn die Hälfte (wie in Baden-Württemberg) oder sogar zwei Drittel (wie in Rehinland-Pfalz) der Wähler vorab zu Hause abstimmt, dann hat das Konsequenzen auf die Wahlkampführung und die strategische Politikplanung generell. Dies mag bei diesen Wahlen dazu beigetragen haben, dass sich Stimmungen im Zuge der Maskenaffäre nur zu geringen Teilen auf das Wahlergebnis der CDU ausgewirkt hat.
Als Fingerzeig für die Bundestagswahl sind diese Landtagswahlen (wie fast immer) nur sehr eingeschränkt zu sehen. Auch wenn die Corona-Krise momentan sowohl die Bundes- als auch die Landespolitik dominiert, standen in beiden Ländern landespolitische Themen bei der Wahlentscheidung im Vordergrund. Die Bewertung der Bewältigung der Pandemie spielte dabei eine große Rolle und kam beiden Landesregierungen zugute. Auf der anderen Seite sind andere Politikfelder weiterhin in Bund und Ländern wichtig. Daher wird es in den nächsten Monaten von großer Bedeutung sein, die Relevanz dieser Themenbereiche zu erkennen und die Kompetenz zur Lösung dieser Probleme mit entsprechend attraktivem Personal zu demonstrieren. Für die Bundestagswahl sind noch alle Optionen offen.
Autor: Dr. Gerhard Hirscher

Dr. Gerhard Hirscher
Leitung
